In the Mood for Lycra
21.07.2025
8 min Lesezeit
Zwischen Stahl und Spandex: Kay Matter macht sich auf die Suche nach den Fragen um Männlichkeit und Zugehörigkeit.
„Quando ancora non avevo il mezzo
Con le tipe ero rischio friendzone
Le fughe dai controllori senza biglietto, uh
ATM fuck, ora guido il mezzo
Giro con lei sopra un Audi […]
Quando passo in piazza, fanno gli applausi“
Dt.: „Als ich noch keine Karre hatte / war bei den Mädels immer in Friendzone Gefahr / ohne Ticket auf der Flucht vor Kontrolleuren / Geldautomat, fuck, jetzt fahr ich ne Karre / Ich cruise mit ihr in einem Audi / Wenn ich übern Platz fahr, applaudieren sie.“
Il Pagante feat. Emis Killa, Il Mezzo
Lorem Ipsum
Wenn man mich nach einem geeigneten Vehikel fragen würde, um in die In-Group der Männer hinüber zu rollen, würde mir wahrscheinlich als Erstes ein rotes Cabrio einfallen, oder ein schwarzer SUV. Vielleicht auch ein Pick-up in Khaki. In jedem Fall aber: ein Auto. Nicht umsonst hat die Politikwissenschaftlerin Cara Dagget 2018 den Begriff Petro-Masculinity (abgeleitet von petroleum = Erdöl) geschöpft: Er beschreibt eine vorrangig weiße, hegemoniale Männlichkeit, die sich über das Verbrennen fossiler Rohstoffe und eine Leugnung des Klimawandels definiert. Das Ticket zu dieser Gruppe? Ganz einfach, ein Führerschein.
Ich wäre nicht die erste trans-maskuline Person, die sich nach dem Autofahren sehnt. So schreibt zum Beispiel Schriftsteller*in Cyrus Dunham in deren Transition-Memoir A Year Without a Name:
„I fantasized about driving down the mountain in a convertible, top down, leaning back in the driver’s seat, open to the world instead of hunched over in hiding […].“ (Dt.: „Ich stellte mir vor, in einem Cabrio den Berg hinunterzufahren, mit offenem Verdeck, zurückgelehnt im Fahrersitz, offen gegenüber der Welt, anstatt mich geduckt zu verstecken […].“)

/origin-imgresizer.eurosport.com/2017/07/09/2124380-44444874-2560-1440.jpg)
Lorem Ipsum
Mit dem Autofahren habe ich es als Teenie versucht, aber ich besitze bis heute keinen Führerschein, weil meine Fahrstunden mit neunzehn ein jähes Ende nahmen, als mein Fahrlehrer Ueli (seine Fahrschule hieß „Ueli der Fahrlehrer“ und bestand aus einem Mercedes und ihm) nach der achten Fahrstunde in Rente ging. Er schickte seine Rechnung und das war’s dann vorerst mit mir und „dem Lappen“, wie der Führerschein in der Schweiz umgangssprachlich genannt wird.
Wenn ich darüber nachdenke, fällt mir auf, dass Fahrräder und Männlichkeit für mich schon immer verknüpft sind. Als ich ein Kind war und selbst noch mit Stützrädern fuhr, klemmte sich mein bester Freund B. eine plattgedrückte PET-Flasche zwischen Rahmen und Hinterrad, um wie ein Hell’s Angel zu klingen. Das Plastik der leeren Wasserflasche knatterte bei jeder Umdrehung.
Ein anderes Bild: Unsere beiden Väter, wie sie mit schlammverspritzten Waden und winzigen Fliegen in den Beinhaaren von ihren Rädern steigen, bei jeder Bewegung Schweißtropfen abwerfend, die auf B. und mich niederregnen, als wir zu ihnen aufschauen.
Oder: Die schmalen Körper der Tour-de-France Athleten, die über den Röhrenfernseher meiner Eltern flitzen, ich auf dem kalten Steinboden, mein Vater drei Wochen lang ununterbrochen am Fernseher festgeklebt, empathisch fluchend. (Meine Mutter steht hinter ihm, bügelt.)
Heute ziehe ich mir selbst melodramatische Rennrad-Dokus rein, wenn ich weinen will und nicht kann. Es funktioniert jedes Mal. Da ist Greg LeMond, der von seinem Schwager bei einem Jagdunfall mit einer Schrotflinte angeschossen wird, 20 kg abnimmt, leidet, leidet, und schließlich die Tour de France gewinnt, seiner Frau in die Arme fällt. Da ist Mark Cavendish, der nach einer EBV-Infektion chronische Fatigue entwickelt und eine Essstörung, aus dem Team geworfen wird und nach Monaten des Kämpfens eine Etappe gewinnt, sich auf den Boden hockt und unter den Kameras der Journalist*innen in seine Hände schluchzt, nicht mehr aufhört.
Nach knapp 30 km lege ich einen Boxenstopp ein. Am Ortsschild kommt mir ein Rennradfahrer entgegen. Er hebt bei 40 km/h die Hand, ruft mir ein „Ciao fra!“ (dt. „Hallo Bro!“) zu, saust an mir vorbei.
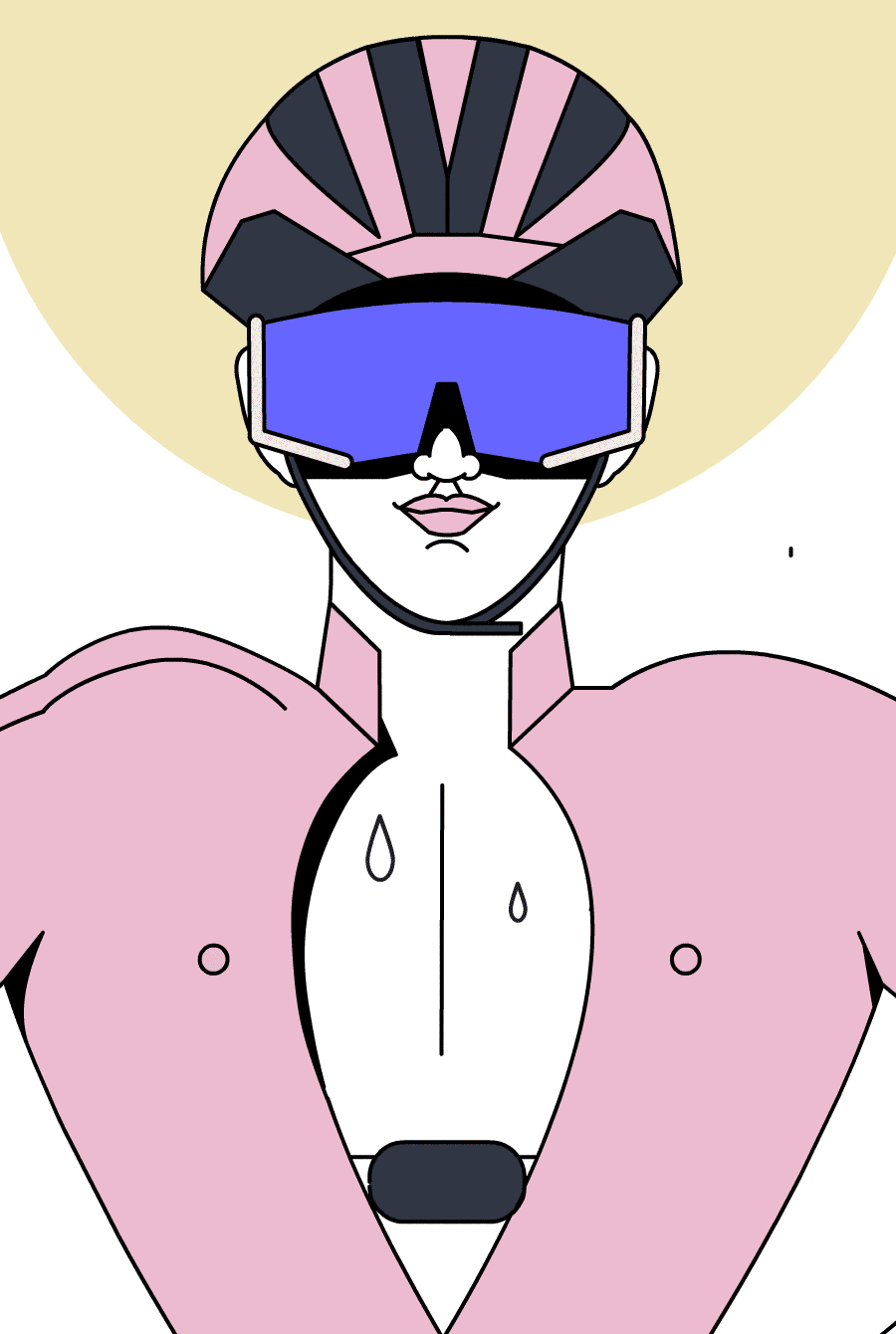

„And suddenly, the world feels different. […] Like suddenly the culture of the world is intelligible and so I am intelligible to the world.“
Dt: „Und auf einmal fühlt sich die Welt anders an. […] Als ob die Kultur der Welt für mich auf einmal lesbar wäre und ich für die Welt.“
Casey Plett, On Community
Lorem Ipsum
„Ciao fra“?? Ist er das, der Moment? Die Begegnung, die ich in allen möglichen Kontexten unter größtem Aufwand herzustellen versucht habe? Warum gelingt sie auf einmal, ausgerechnet in diesem Augenblick, als ich unterzuckert und außer Atem in einer hauchdünnen, hautengen Hülle den Hügel hinaufkrieche?
„What I’m talking about here, it’s a feeling like I’m sharing something with not a small group but the world.“ (Dt: „Wovon ich hier spreche, ist das Gefühl, etwas mit der Welt zu teilen – und nicht nur mit einer kleinen Gruppe.“)
(Plett schreibt auch: „This feeling is dangerous.“; Dt.: „Dieses Gefühl ist gefährlich.“)
Was unsere Väter und die Rennradprofis eint, ist, dass für sie auf dem bici auf einmal andere Regeln gelten: Sie dürfen, nein, sollen sich die Beine rasieren, enge Hosen tragen, dünne Arme haben, einen leichten Körperbau. Ich muss an all die cis-het-Cycling-Männer auf TikTok und Instagram denken, die ein Reel nach dem anderen raushauen, in denen sie selbstironisch jede „excuse to wear lycra“ nutzen. (Wer will nicht ab und zu enge Hosen mit Arschpolster tragen?)
Ich nehme meinen Helm ab, klemme ihn mir unter den Arm und trete durch den grün-weiß-roten Fliegenvorhang in die Dorfbar ein. Die alten Männer am banco drehen die Köpfe zu mir. Ich stelle mich in die einzige schmale Lücke zwischen zweien von ihnen. „Ciao caro“ (dt. „Hallo mein Lieber“), sagt die Frau hinter der Bar, „di dove sei partito?“ („wo bist du gestartet?“) Partito, mit -o, der männlichen Endung. Ich höre mich mit dem Namen des Dorfes antworten.
Genügt etwa eine Schicht Lycra, um mich in plain sight zu verstecken? Neulich noch glaubte ich, ich müsste 20 kg zunehmen und mir Muskelberge auf meine Schultern trainieren, um endlich entzifferbar zu sein. Aber vielleicht ist die sicherste Schale für mich eine elastische Rüstung aus Kunstfaser, mit Salzrändern anstatt Rostflecken.

