„Mein Name ist Bond. James Bond“: Zweifellos gehören diese Worte zu den bekanntesten der Filmgeschichte und lösen in jedem Kopf sofort Bilder jenes Agenten aus, der für den britischen Geheimdienst durch die Welt fliegt und gerne Wodka Martini trinkt – und zwar geschüttelt, nicht gerührt. Dass die explosiven Geschichten rund um Bond, dem Schauspieler wie Sean Connery und Roger Moore zu Unsterblichkeit auf der Kinoleinwand verhalfen, auf Romanen beruhen, wissen nur wenige.
1953 veröffentlichte Ian Fleming seinen Erstling „Casino Royale“, er spiegelte dabei nicht nur die mehrheitlich auf Konsum und Amüsement ausgerichtete Londoner Nachkriegsgesellschaft, sondern griff auch auf eigene Spionage-Erfahrungen zurück: 1933 hatte Fleming als Korrespondent für Reuters in der Sowjetunion gearbeitet und von dort aus Informationen an das britische Außenministerium geliefert. Fleming arbeitete dann während des Zweiten Weltkriegs für den britischen Marinegeheimdienst und schrieb sogar vor der Besetzung des Landes einen Bericht über die deutsche Wirtschaft für das Auswärtige Amt. Obwohl James Bond, der Frauen genauso zu sich nimmt wie Champagner, das Genre des Spionageromans bis heute prägt, war er nicht dessen erster Vertreter.
Männliche Spione sind in der Literatur klar in der Überzahl
Aber was ist ein Spionageroman eigentlich? Auf eine allgemeingültige Definition konnten sich Literaturwissenschaftler bis heute nicht einigen. Einsortiert wird er zumeist in die Kriminalliteratur und vom Detektivroman unterschieden. Auch eine Trennlinie zwischen Thrillern, wie bei Fleming, und stärker auf die realistische Darstellung von Geheimdiensten abzielende Romane wird bisweilen gezogen. Mit wenigen Ausnahmen sind Spione in der Literatur – anders als in der Realität – darüber hinaus Männer.

Hoagy Carmichael, Flemings Vorstellung von James Bond, Image via wikipedia.org
Bei Joseph Conrad, der lange vor Fleming 1907 „Der Geheimagent. Eine einfache Geschichte“ veröffentlichte, heißt dieser Mann Mr. Verloc. Im offiziellen Leben Besitzer eines Ladens für Kuriositäten und Erotika in London, arbeitet er unter der Hand für eine nicht näher benannte geheime Organisation und versorgt diese mit Informationen über anarchistische Kreise. Aber nicht zu deren Zufriedenheit: „Der eigentliche Beruf eines ‚agent provocateur‘ ist zu provozieren. Soweit ich aus Ihrem Bericht ersehe, haben Sie in den letzten drei Jahren nichts getan für das Geld, das sie eingestrichen haben“, wirft ihm sein Kontaktmann vor und beauftragt den leicht lethargischen Agenten mit einem Bombenanschlag auf das Observatorium in Greenwich, den er im Namen der Anarchisten ausführen soll – ohne Rücksicht auf die Sicherheit seiner Familie, die dabei zu Schaden kommt.
Der eigentliche Beruf eines ‚agent provocateur‘ ist zu provozieren. Soweit ich aus Ihrem Bericht ersehe, haben Sie in den letzten drei Jahren nichts getan für das Geld, das sie eingestrichen haben.
Maurice Castle, Hauptfigur in „Der menschliche Faktor“ von Graham Greene (1978), sorgt sich viel stärker um Frau und Kind. Er ist ein farbloser und pflichtbewusster Mann, der offiziell beim britischen Außenministerium arbeitet, aber dort geheimdienstlich relevante Nachrichten aus Afrika betreut. Um keinen Preis möchte er Aufmerksamkeit auf seine Person richten, denn Castle, das wird im Verlauf des Romans deutlich, ist jene undichte Stelle, nach der das MI6 mit Akribie sucht: Er liefert Informationen an die Sowjetunion, da diese ihm damals half, seine spätere Frau unbehelligt aus Südafrika zu schleusen. Castle, der längst das Rentenalter erreicht hat, ist arbeitsmüde geworden und ertränkt seine Sorgen und Ängste regelmäßig im Whiskey-Tumbler, um den Depressionen zu entgehen.
Greene trat damit in die Fußstapfen einer der wohl bekanntesten Autoren von Spionageromanen: John le Carré hatte 1963 mit „Der Spion, der aus der Kälte kam“ seinen Protagonisten Alec Leamas ins Rennen geschickt: Ein britischer Agent, der sich der Stasi als Doppelagent anbietet, um seinen Erzfeind dort zu Fall zu bringen. In den vergangenen Monaten waren mehrere seiner Kontakte von der Gegenseite ermordet worden, was ihn dazu bringt, sich emotional immer stärker zu verschließen.
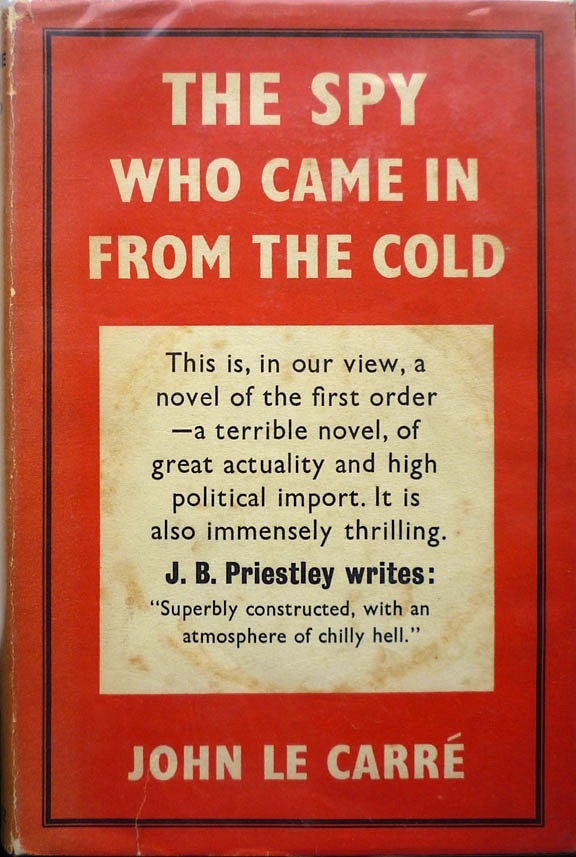
John le Carré, The Spy who came in from the Cold (Der Spion, der aus der Kälte kam), 1963, Erste Edition, Image via wikipedia.org
„Wir müssen ohne Gefühl leben, ist es nicht so? […] Wir spielen es uns gegenseitig vor, all diese Härte. Aber so sind wir in Wirklichkeit gar nicht. Ich meine, man kann nicht die ganze Zeit draußen in der Kälte sein; man muss auch einmal aus der Kälte hereinkommen...“, versucht ihn sein Chef bei der Überprüfung seiner weiteren Tauglichkeit als Agent aus der Reserve zu locken. Leamas spricht gerne und oft dem Alkohol zu, die Ehe mit seiner Frau ist längst geschieden und der Kontakt zu seinen Kindern besteht nicht mehr: Eine gebrochene Figur, die aus Frust über die private Unzulänglichkeit ganz in der nervenaufreibenden Rolle des Spions aufgeht.
Eine gebrochene Figur geht ganz in ihrer Rolle als Spion auf
Das gilt auch für Karl Müller, der Hauptfigur aus Jacques Berndorfs Agentenroman „Ein guter Mann“ (2005). Müller, Mitarbeiter des BND und für Überwachung des Nahen Ostens eingesetzt, ist ein höchst unauffälliger Mann; spontan muss er nach Damaskus fliegen, weil sein Kontakt Achmed über die verschlüsselte Leitung einen Notruf durchgegeben hat. Auch wenn Reisen ins Ausland als Agent immer mit Gefahren und exakt abgesprochenen Vorsichtsmaßnahmen verbunden sind, zieht Müller sie noch immer dem Aufenthalt zu Hause vor: Die Ehe mit seiner Frau ist längst erkaltet und sein Vater liegt im Sterben. Sein Chef ermahnt ihn, seine privaten Probleme zu klären, damit seine Arbeit im Bundesnachrichtendienst nicht davon beeinflusst wird – Gefühle haben in der Spionage nichts zu suchen.

Jaques Berndorf, Ein guter Mann, 2005, Image via booklooker.de
Oder sie sind den Frauen vorbehalten. Diese stehen bis heute selten als Agentin im Mittelpunkt eines Spionageromans, und wenn doch, so verstricken sie sich früher oder später in eine Liebesgeschichte. In „Honig“ von Ian McEwan (2012) lässt der Autor die junge Serena in den Siebziger Jahren als Mitarbeiterin beim MI5 beginnen, wo man sie zunächst zu Schreibtischarbeit verpflichtet, bevor sie für eine größere Mission eingesetzt wird: Sie soll in der Rolle einer Literaturagentin einen jungen Autor für ein vom Geheimdienst finanziertes Literaturmagazin gewinnen, das Texte von regierungsfreundlichen Schriftstellern abdruckt.
McEwan greift dabei manchmal etwas zu tief in die Klischeekiste: „Hatte ich Zweifel oder moralische Bedenken? Zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ich war glücklich, dass man mich ausgewählt hatte. Ich fühlte mich der Aufgabe gewachsen und hoffte dabei, Lob aus den höheren Etagen ernten zu können – ich war ein Mädchen, das gelobt werden wollte“, erzählt Serena an einer Stelle, kurz bevor sie sich in ihr Zielobjekt verliebt und eine Beziehung mit dem Mann eingeht. Der Codename „Honig“ für die Mission ist bereits aussagekräftig genug: Als „Honigfalle“ bezeichnete man weibliche Lockvögel, die durch Einsatz ihres Körpers an Informationen gelangten. Eine Aufgabe, die Agentinnen auf ihre weiblichen Reize reduziert – und zudem ein Phantasieprodukt der Literatur ist.
Hatte ich Zweifel oder moralische Bedenken? Zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

Ian McEwan, Sweet Tooth (Honig), 2012,
Erste Edition, Image via wikipedia.org
Liz Carlyle, Hauptfigur von Stella Rimingtons Roman „Angstpartie“ (2008), sieht sich nicht in der Rolle des wimpernklimpernden Mädchens. Ihre Aufgabe ist es, den Anschlag auf eine Friedenskonferenz mit dem Nahen Osten zu verhindern, bei dem auch der Mossad seine Finger im Spiel haben soll. Carlyle zählt zu den zäheren Protagonistinnen, die sich von der männlichen Konkurrenz nicht die Butter vom Brot nehmen lassen; und doch verzichtet Rimington – die 1992 zur ersten Chefin des MI5 gewählt wurde – ebenfalls nicht darauf, ihre Protagonistin als junge und attraktive Frau zu schildern, die sich unglücklich in ihren Chef verliebt und zu einem Treffen mit ihrem Kontaktmann bei der CIA extra die neuen Riemchen-Stilettos trägt. Und auch Lauren Wilkinson, deren Roman „American Spy“ (2019) rückblickend die Erfahrungen der Schwarzen CIA-Agentin Marie Mitchell erzählt und dabei strukturellen Sexismus und Rassismus bei den Geheimdiensten thematisiert, kommt nicht ohne Liebesgeschichte aus.
Im Gegensatz zu Spionageromanen aus Großbritannien, die auf eine lange Tradition zurückblicken und in den meisten Fällen eigenbrötlerische und melancholische Hauptfiguren in den Mittelpunkt stellen, bekam das Genre auf dem deutschen Buchmarkt erst vor wenigen Jahrzehnten Aufwind. Auffällig ist dort das immer wiederkehrende Thema familiärer Verwicklungen in Spionagetätigkeiten, sei es während des Nationalsozialismus oder mit Bezug auf die deutsch-deutsche Teilung.
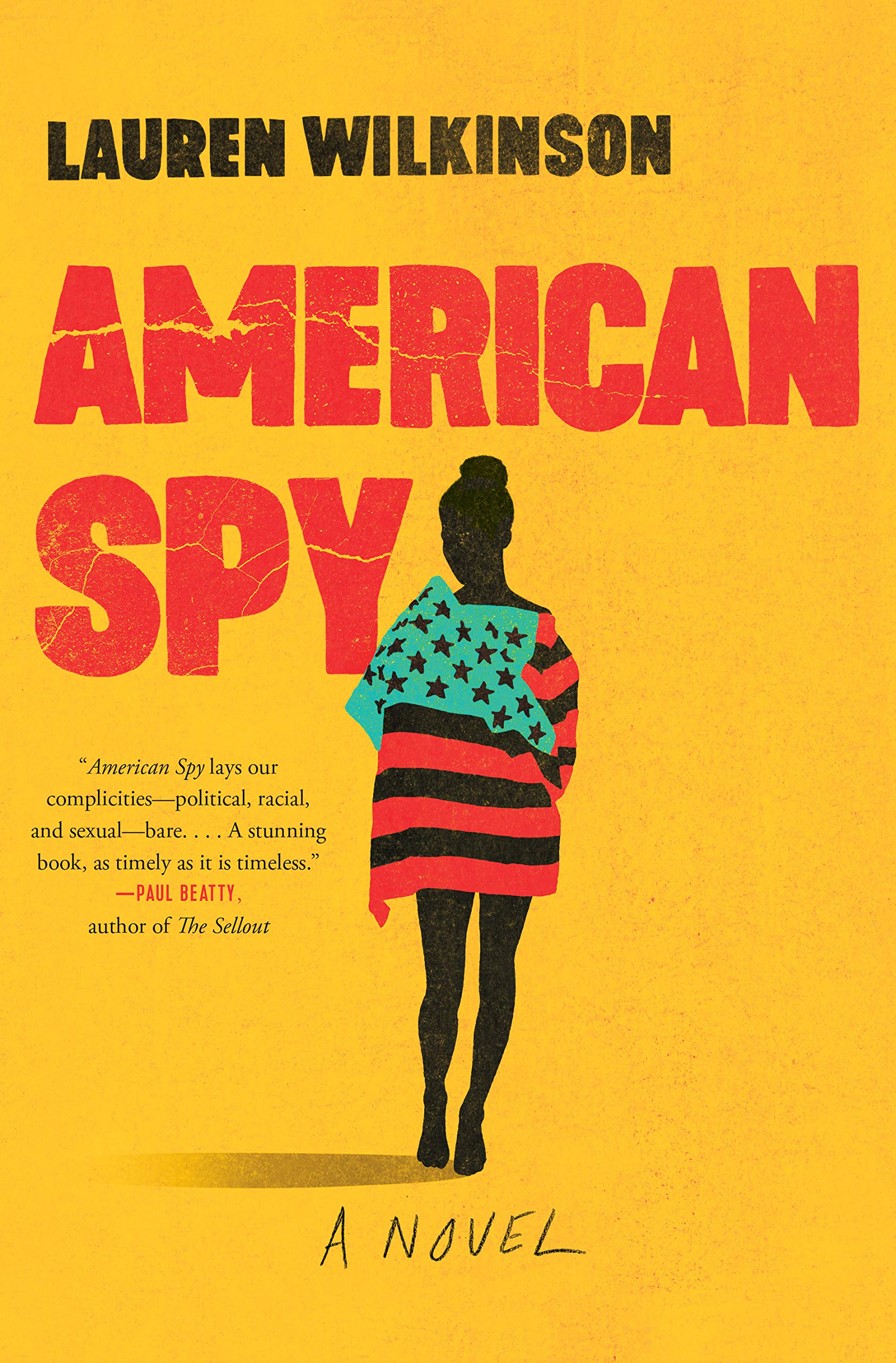
Lauren Wilkinson, American Spy, 2019, Image via amazon.com
So erzählt Dirk Brauns in „Die Unscheinbaren“ (2019) die Geschichte eines Jungen, der mitansehen muss, wie seine Eltern von der Stasi festgenommen werden, weil sie für die Bundesrepublik spioniert haben – eine Geschichte, die auf seinen eigenen Erlebnissen basiert. Das gilt auch für Eugen Ruge, dessen Roman „Metropol“ (2019) von seiner Großmutter handelt, die in den Dreißiger Jahren für den Nachrichtendienst Komintern in Moskau arbeitet, sowie Ulla Lenze, die in „Der Empfänger“ (2019) die Tätigkeit ihres Großvaters beim deutschen Geheimdienst in Amerika während des Zweiten Weltkriegs verarbeitet.
Obwohl sich die Romane länderübergreifend in Struktur und Personal also häufig ähneln, so bleibt die Definition und Abgrenzung von anderen Genres weiterhin schwierig. Der Experte für Spionageliteratur Jost Hindermann findet in seiner Abhandlung zu britischen Spionageromanen die treffenden Worte: „Ein Spionageroman ist ein Roman, der von Spionage handelt.“
Ein Spionageroman ist ein Roman, der von Spionage handelt.
