Mit einem Dokumentarfilm ehrt Ulrike Pfeiffer den Anfang 2017 verstorbenen Filmemacher und Filmkünstler Werner Nekes. Jetzt im Kino.
Die diversen Disziplinen der Kunst sowie auch unser Empfinden ebenjener lassen sich im Großen und Ganzen auf zwei Kategorien zurückführen: Raum und Zeit. Die Malerei ist lediglich im Raum wahrnehmbar – als materialisiertes Werk können wir sie als Ganzes statisch, also quasi „zeitlos“ betrachten; ebenso Skulpturen, Architektur et al. Die Musik hingegen ist ausschließlich in der Zeit wahrnehmbar: Weder Popmusik noch eine klassische Sinfonie sind räumlich erfahrbar, sie finden in der Zeit statt und der Klang selbst löst sich gleichsam in der Zeit wieder auf.
Das 20. Jahrhundert bescherte uns, im gleichen Maße wie Zeit als Einheit im Rahmen der Industrialisierung einen immer größeren Stellenwert einnahm, auch immer mehr „zeitliche Kunst“. In jene Kategorie fällt neben der Performance-Kunst natürlich auch Film als Medium, mit der Besonderheit, dass hier noch die materielle Ebene des Filmmaterials selbst hinzukommt. Dieses beinhaltet schon sichtbar die einzelnen Bestandteile des gesamten Films, doch erst durch die zeitliche Abfolge jener Einzelbilder entsteht der Zauber des bewegten Bildes.
Wir sind ja noch hier
Der deutsche Regisseur Walter Ruttmann beschrieb bereits 1919 die Möglichkeiten der Filmkunst als „Malerei mit Zeit“ und sah einen neuen Künstlertypus im Entstehen, „der etwa in der Mitte von Malerei und Musik steht“. Beim deutschen Film-Avantgardist Werner Nekes klingt das in Ulrike Pfeiffers Dokumentarfilm „Werner Nekes – Das Leben zwischen den Bildern“, der auf der Berlinale 2017 uraufgeführt wurde, wie folgt: „Ich versuche einen Film zu machen, [...] als hätte Kirchner schon eine Kamera gehabt, mit der er malen konnte.“ Diese Aussage allein verrät schon etliches über Arbeitsweise und Reflexionsvermögen, die in der aktuellen Filmkunstszene leider ein wenig unterrepräsentiert scheint. Auf die passende Frage dazu, ob die Avantgarde tot sei, antwortet Nekes keck: „Noch nicht, wir sind ja noch hier."

Doch noch einmal zurück auf Anfang: Werner Nekes wird 1944 in Erfurt geboren, studiert Sprachwissenschaft und Psychologie in Freiburg und Bonn und beginnt ab 1965 damit, eigene Experimentalfilme zu drehen. Die Freundschaft mit der Künstlerin Eva Hesse sowie die Auseinandersetzung mit deren Werk führten bei Nekes, der sich selbst als Maler versuchte, zu einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Zusammenspiel von Film und Malerei.
Radikal neues Kino
Die Filmleinwand als malerische Fläche zu begreifen, die Kamera also nicht bloß zu einem dokumentarischen Aufnahmegerät dessen, was das Auge ohnehin schon sehen kann, zu degradieren, so könnte man den Ansatz des Filmemachers zusammenfassen. Mit seiner damaligen Frau Dore O., mit der Nekes etliche Filme gemeinsam realisierte, zieht er schließlich nach Hamburg, schließt sich der dortigen Filmszene und wird dort Professor an der Kunsthochschule: Der Filmemacher möchte seine radikalen Ideen eines neuen Kinos an Studenten weitergeben und die Vorgeschichte des Mediums erforschen.


Das Interesse an jener Vorgeschichte des Films findet Ausdruck in der bedeutenden Sammlung, die der Avantgardist sich über die Jahre aufgebaut hat. Nekes sammelte alles, was auch nur im Entferntesten mit der Vorgeschichte des Films zu tun hat: Laterna Magica, Thaumatrop, optische Spielzeuge und anamorphotische Gemälde – aus seiner Sammlung finden sich etwa auch Teile in der aktuellen SCHIRN-Ausstellung Diorama. Sein Interesse ist aber kein historisches, das Sammeln und der poetische Blick stehen im direkten Zusammenhang und nehmen starken Einfluss auf seine eigene Arbeit und gelten der Suche nach filmischen Prinzipien, um, wie Nekes selbst sagt, durch Gestaltungsformen Einfluss auf das Denken des Betrachters zu nehmen. In „Jüm-Jüm“ (1970) schneidet der Filmemacher so eine Filmrolle in kleine Schnipsel, die dann wieder zufällig zusammengefügt werden; für andere Filme wie „Mirador“ (1978) baut er spezielle Apparaturen, die das aufgenommene Bild schon während der Aufnahme modifizieren.
Ein aufmerksamer Geist
Ulrike Pfeiffer lässt etliche Weggefährten, wie den Kameramann Bernd Upnmoor, den Theoretiker Bazon Brock, den Musiker Antony Moore und natürlich Helge Schneider, mit dem Nekes gemeinsam sein wohl bekanntestes Werk „Johnny Flash“ gedreht hatte, zu Wort kommen, während der Filmwissenschaftler Daniel Kothenschulte und Alexander Kluge den Experimentalfilmer interviewen. Und natürlich den Filmemacher selbst: ewig rauchend, dozierend, Zusammenhänge erklärend - ein aufmerksamer Geist, der von seinen Freunden manchmal auch als besserwisserisch empfunden wird.

„Werner is’n Kind“, sagt Helge Schneider an einer Stelle, denn nur ein Kind könne so einen interessierten und wachen Blick auf die Welt haben. Ulrike Pfeiffers schöner Dokumentarfilm zeigt uns Nekes als ernstes Kind, will man zustimmen: als ewig interessiertes, die Dinge immer gewichtig nehmendes Kind. Pfeiffers Film nimmt uns mit in die Welt des Avantgardisten, führt ein in das Werk aus über 100 Kurz- und Langspielfilmen und macht gleichzeitig einen filmgeschichtlichen Abriss über die Möglichkeiten dessen, was Kino sein kann, abseits des Genres Spielfilm. Ihr Dokumentarfilm ist leider zeitgleich ein Nachruf geworden: Nekes starb Anfang des Jahres in Mühlheim und somit sicher, da muss man ihm wieder einmal recht geben, auch ein Teil der Avantgarde des Experimentalfilmes.

Artikel, Filme, Podcasts - das SCHIRN MAGAZIN direkt als WhatsApp-Nachricht empfangen, abonnieren unter www.schirn-magazin.de/whatsapp

Magma Maria: Ein Ausstellungs-Juwel in Offenbach
Das Künstler*innen- und Kurator*innen-Kollektiv Magma Maria bringt im gleichnamigen Off-Space seit 2020 Kunst nach Offenbach. Ihre Ausstellung „Floor...

„Gegen die Vereindeutigung der Welt”: Quer durch die Berlinale 2024
Auch dieses Jahr zog die Berlinale wieder Filmschaffende und Cineast*innen aus aller Welt an. Trotz des auf die Hälfte reduzierten Filmprogramms...

Ukrainische Kunst in Frankfurt - Wenn Anatomie politisch wird
Die Arbeiten der ukrainischen Künstlerin Vlada Ralko gehen unter die Haut – im wahrsten Sinne des Wortes. Im Mittelpunkt ihrer Zeichnungen und...

Städelschule Rundgang 2024. Erste Eindrücke
Alle Jahre wieder: Der Rundgang der Städelschule hat sich längst als zeitgenössisches Kunsthighlight in Frankfurt etabliert. Vom 9.-11. Februar zeigen...

Verloren im Urwald des Anthropozäns
Bis zum Herbst ist in Darmstadt die Ausstellung „Wait, when the moon rises“ kostenfrei im öffentlichen Raum zu sehen. Darin zeichnen internationale...

Abe Frajndlichs Porträt der Vielseitigkeit
Wie gelingt es innerhalb der Fotografie, den Blick über die Oberfläche der Darstellung hinaus zu lenken und Einsicht in den Charakter von Orten und...

Ein Diamant im Angebot: Das Museum of Urban Culture
Wo früher Schmuck und Uhren zum Verkauf angeboten wurden, wird heute Kunst ausgestellt, Musik gemacht und bei Getränken gequatscht: Das Diamant...

Performing Democracy. Die Kunst der Demokratie
Anlässlich des 175. Paulskirchenjubiläums lädt das Netzwerk Paulskirche zu den „Frankfurter Tagen der Demokratie“. Was kann Kunst in der aktuellen...
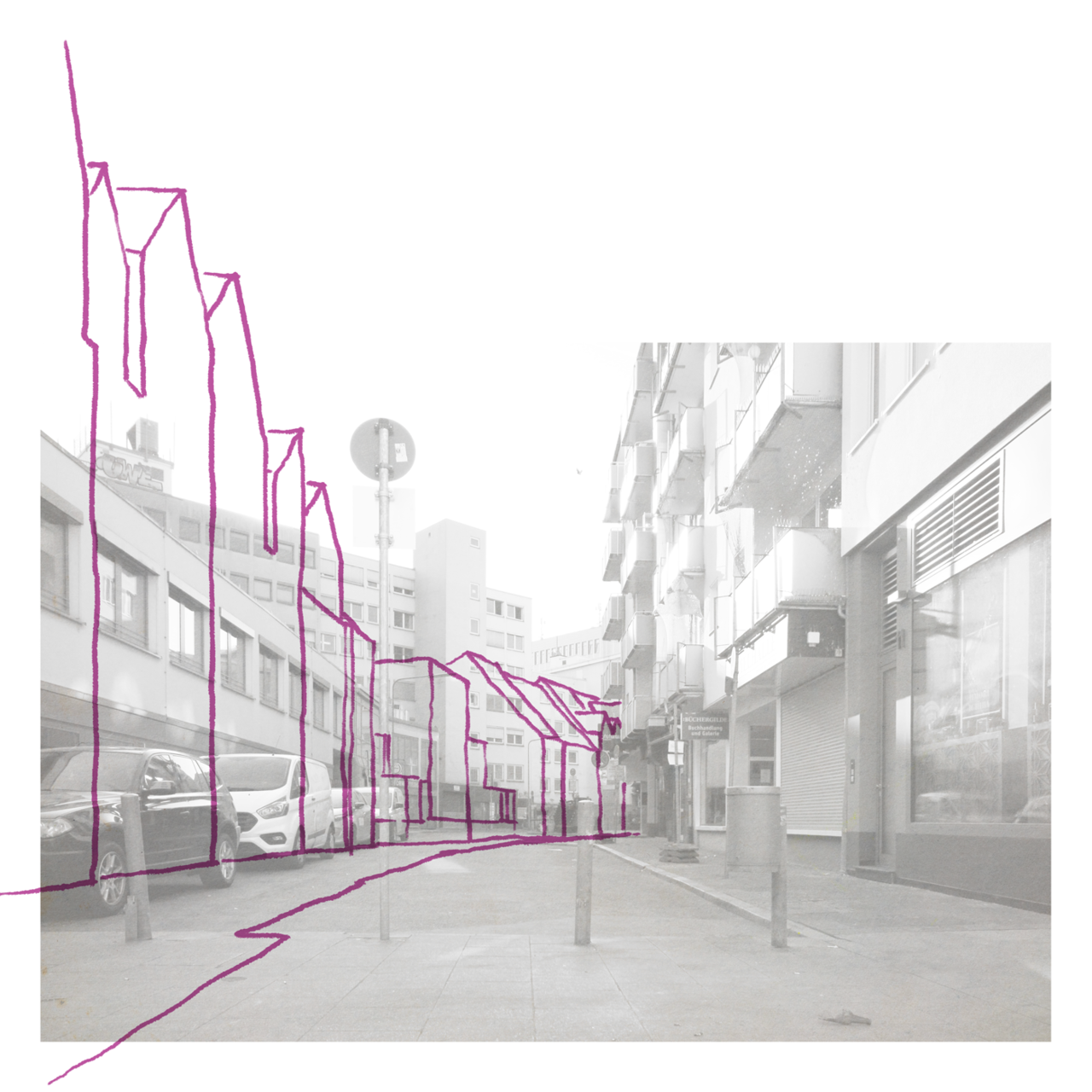
„Geschichte ist nicht die Vergangenheit“: Ein Gespräch mit Mirjam Wenzel und Meitar Tewel
Die Frankfurter Judengasse gehörte einst zu den bedeutendsten Zentren jüdischen Lebens in Europa. Heute jedoch sind ihre Spuren weitgehend...

Highlights der Berlinale 2023
Auf der diesjährigen Berlinale scheint sich die Realität stärker als in den Vorjahren auf der Leinwand zu manifestieren. Wir zeigen unsere...

Städelschule Rundgang 2023 - Erste Einblicke
Vom 10.-12. Februar öffnet die Städelschule in Frankfurt ihre heiligen Hallen für die Öffentlichkeit und bietet einen Einblick in das künstlerische...

Queere Geschichte(n)
Aufarbeitung diversifizieren: Mit künstlerischen Interventionen beleuchtet das NS-Dokumentationszentrum München die Selbstermächtigung der queeren...
